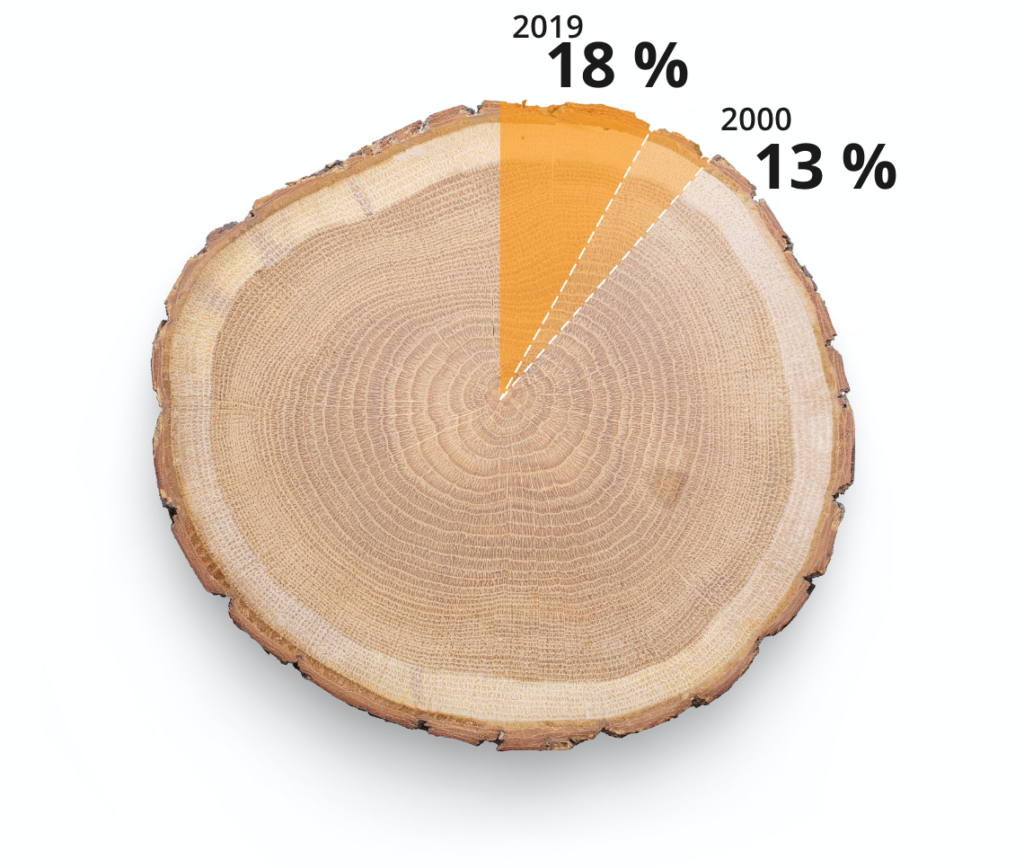Kategorie-Archive: Magazin
emco Bau auf der A@W in Berlin
Am 19. und 20. Oktober 2022 fand wieder die ARCHITECT@WORK in Berlin statt. emco Bau [...]
01
Dez
Dez
3-Zonen-Reinigung im Aachener Dom
Vor mehr als 1.200 Jahren machte Karl der Große Aachen zum Mittelpunkt seines sagenhaften Reiches. [...]
13
Nov
Nov
Sanierung & Effizienz
Wir wissen es nicht erst seit der 13. Architektur-Biennale: ‚Reduce, reuse, recycle‘ lautet die Maxime [...]
02
Okt
Okt
Urlaub im Hotel
Die Sommerferien sind da – und endlich wieder Urlaub ohne Corona-Einschränkungen. Jetzt locken Ziele weltweit, [...]
04
Aug
Aug
Außen pfui, innen hui? Eingangsbereich sanieren!
Ist ein Gebäude erst einmal bezogen und in Betrieb, schaut man als Nutzer in der [...]
15
Jun
Jun
Von Anfang an mitplanen: emco 3-Zonen-Reinigung
Bei der Planung von Bau oder Sanierung eines Gebäudes ist es sinnvoll, auch eine effektive [...]
19
Mai
Mai
Juridicum Kiel Sauber und barrierefrei
In Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Kindergärten erfüllen Sauberlaufsysteme einige gebäudespezifische Aufgaben. Denn neben der [...]
15
Apr
Apr
Barrierefreiheit Wichtig für alle
Barrierefreiheit betrifft das ganze Leben: Orte, Räume und auch Kommunikationsmittel. Können diese nicht barrierefrei genutzt [...]
15
Feb
Feb
Nachhaltig bauen – Wie geht das?
Am 19. und 20. Oktober 2022 fand wieder die ARCHITECT@WORK in Berlin statt. emco Bau [...]
15
Feb
Feb